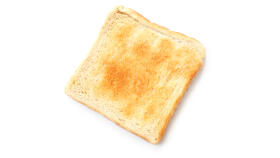Die Darmbarriere
Der Darm bietet eine riesige Angriffsfläche für Krankheitserreger & Co. Umso wichtiger ist eine funktionierende Abwehrfront, die uns wirksam vor ungebetenen Gästen schützt.
Riesige Angriffsfläche für Erreger & Co.
Obgleich der Darm sich innerhalb unseres Körpers befindet, ist er unsere größte Kontaktfläche zur Außenwelt – und um ein Hundertfaches größer als die Haut. Diese riesige Ausdehnung ist nötig, damit die Nährstoffe effizient ins Blut aufgenommen werden können. Damit bietet der Darm jedoch auch eine enorme Angriffsfläche für Krankheitserreger oder schädliche Fremdstoffe. Um uns vor diesen Gefahren zu schützen, verfügt der Darm über verschiedene Abwehrmechanismen, die zusammen als Darmbarriere bezeichnet werden. Sie verhindern, dass Keime oder schädliche Substanzen ins Körperinnere gelangen.
Die Darmbarriere: Drei wirksame Verteidigungslinien
Die Darmwand muss zwei zentrale Aufgaben erfüllen: Zum einen muss sie durchlässig sein für die aufgenommenen Nährstoffe, zum anderen muss sie aber verhindern, dass Bakterien, Viren, Pilze oder Schadstoffe durch die Darmwand ins Blut gelangen. Um das zu gewährleisten, muss die Durchlässigkeit der Darmwand exakt reguliert sein. Mediziner sprechen in diesem Zusammenhang auch von einer „selektiven Darmbarriere“ – es muss also genau geregelt sein, was die Darmwand passieren darf und was nicht.
Zur Abwehr von Krankheitserregern und schädlichen Fremdstoffen werden drei Verteidigungslinien aktiv: Neben der Darmflora sind das die Darmschleimhaut und die Abwehrzellen des Immunsystems, die in der Darmwand lokalisiert sind.
Die Darmflora verfügt über verschiedene Schutzmechanismen
Die „guten“ Bakterien der Darmflora konkurrieren mit krankmachenden Keimen um Nährstoffe und können sie daran hindern, an der Darmwand „anzudocken“. Zudem produzieren sie teilweise auch antibakterielle Stoffe. Zusätzlich versorgen die Darmbakterien die Darmwandzellen mit Nährstoffen, regulieren die Erneuerung der Zellen und auch die Funktion des darmeigenen Immunsystems.
Die Darmschleimhaut wirkt als mechanische Barriere
Die Schleimstoffe (Mucine), die von bestimmten Zellen der Darmschleimhaut produziert werden, wirken als mechanische Barriere. Krankheitserreger verfangen sich in der Schleimschicht, die der Darmwand aufliegt. So wird es ihnen erschwert, an der Darmwand anzuhaften. Außerdem enthält der Schleim auch „Defensine“. Das sind Substanzen, die ebenfalls der Abwehr von Erregern dienen.
In der Darmschleimhaut sind auch die sogenannten Tight Junctions lokalisiert. Diese Zell-Zell-Verbindungen sind schmale Bänder, die die winzigen Zwischenräume zwischen den Zellen der Darmschleimhaut abdichten.
Das darmeigene Immunsystem: Abwehr aus dem Bauch heraus
Etwa 70 Prozent der Abwehrzellen des Immunsystems befinden sich in der Darmschleimhaut. Auch sie spielen eine zentrale Rolle bei der Neutralisation von Schadstoffen und der Abwehr von Keimen im Darm. Gleichzeitig muss das Immunsystem im Darm aber auch unschädliche Nahrungsmittelinhaltsstoffe als solche erkennen und die nützlichen Darmbakterien tolerieren – eine sehr komplexe Aufgabe, die eines stetigen „Trainings“ bedarf.
Hätten Sie's gewusst?
Wenn die Darmbarriere durchlässig wird
Damit die Darmbarriere uns optimal schützen kann, sind neben einer funktionierenden Darmschleimhaut und einer ausreichenden Schleimschicht vor allem auch eine intakte Darmflora und ein aktives Immunsystem wichtig.
Eine ungünstige Ernährungsweise, Infektionen, Stress oder Antibiotika – es gibt viele Faktoren, die die Darmbarriere beeinträchtigen können. Kommt es zu einer Schädigung oder Fehlfunktion, kann das erhebliche Folgen für unsere Gesundheit haben. Denn dann steigt die Darmpermeabilität an: Die Darmwand wird durchlässiger für Krankheitserreger und andere potenziell schädliche Substanzen.
Wenn Keime nicht mehr erfolgreich abgewehrt werden können, steigt die Anfälligkeit für Infektionen. Zudem wird auch das Immunsystem aktiviert, wenn Substanzen ungehindert durch die Darmwand ins Blut gelangen. Dieser Mechanismus könnte erklären, wie sich Allergien und Autoimmunerkrankungen entwickeln. Bei einer Allergie kommt es zu einer überschießenden Reaktion des Immunsystems auf eigentlich harmlose Substanzen (z. B. Nahrungsbestandteile). Im Falle der Autoimmunerkrankungen richtet sich die Abwehr sogar gegen körpereigene Strukturen.
Gut zu wissen: Unter dem sogenannten „Leaky-Gut-Syndrom“ versteht man eine erhöhte Durchlässigkeit der Darmschleimhaut, die mit einer Vielzahl von Erkrankungen in Zusammenhang gebracht wird.
Einig ist die Wissenschaft sich darüber, dass es Störungen der Barrierefunktion gibt. Ob diese allerdings zu Erkrankungen führen können, konnte bisher nicht ausreichend belegt werden. Bei einigen Erkrankungen wird ein Zusammenhang mit einer gestörten Darmbarriere vermutet. Dazu zählen zum Beispiel:
- Darminfektionen
- Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen
- Zöliakie
- Reizdarmsyndrom
- Allergien
- Typ-1-Diabetes
- Übergewicht
- Metabolisches Syndrom
- Autismus